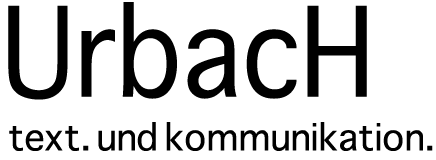South Pole – eine Doppeloper in zwei Teilen
Es schneit an diesem Abend des 2. Februar 2016 in München. Und es ist kalt. Gibt es eine besser abgestimmte meteorologische Einstimmung für meinen Besuch der Doppeloper „South Pole“ von Miroslov Srnka und Tom Holloway? Vor den Säulen des Nationaltheaters fegt der Schneeregen im blau-kalten Scheinwerferlicht über die Köpfe der Besucher. Die „Klanginstallation des Unbewohnbaren“ von Moritz Gagern direkt unter dem Portal tut dazu ihr bestes, einen ersten klanglichen Eindruck der lebensfeindlichen Antarktis mit auf den Weg zu geben. Die PR-Maschinerie für diese einzige Uraufführung der Spielzeit 2015/16 läuft seit Monaten auf Hochtouren. Mir gefällt es, dass eine echte Institution wie die Bayerische Staatsoper alle Kanäle – vor allem auch die digitalen – recht virtuos bespielt, mit Videos, einem eigenen Blog und Filmnächten.
Vor der Königsloge sehe ich dann auf dem Weg zu meinem Platz noch zufällig den jungen Komponisten Srnka im angeregten Gespräch mit Freunden. Direkt vor dem „Basislager“ steht er, einer kleinen Ausstellung zur Oper mit Requisiten und alten Fotos aus der Zeit der Antarktisexpeditionen. Die Uraufführung am 31. Januar wurde ja vom Publikum umjubelt, von der Presse eher mit gemischten Gefühlen wahrgenomen und bewertet. Aber Srnkas unaufgesetztes, lautes Lachen wirkt in diesem Moment auf mich als stillen Beobachter der Szene so positiv und ansteckend. Um was geht es in „South Pole“? Der Librettist Tom Holloway hat das berühmte Wettrennen um den Südpol thematisiert, das sich der Engländer Robert Scott und der Norweger Roald Amundsen 1912 lieferten. Mit dem so lapidaren wie endgültigen Ausgang: Amundsens Sieg, Scotts Tod. Über eines der faszinierendsten Kapitel der an Tragödien ja nicht gerade armen Expeditionsgeschichte der Menschheit gibt es mittlerweile eigentlich so gut wie alles: Bücher, Filme, Hörspiele – und nun eben auch eine Oper. Eine Doppeloper, um genau zu sein. Denn Holloway bedient sich eines dramaturgischen Kunstgriffes, indem er die beiden Expeditionen simultan auf der Bühne agieren lässt. Links kämpft sich Scott mit seinen Leuten, rechts Amundsen und seine Norweger durch das Eis. Und so entfaltet sich das Drama recht schnörkellos und ohne große Umschweife. Srnka greift die Idee der Simultaneität auf – und setzt sie kompositorisch konsequent um. Dabei ist Amundsen seinem Rivalen Scott immer einen kleinen Schritt voraus, gedanklich, auf dem Weg zum Pol und auch musikalisch. Scott bleibt oft nur das – immerhin variierte – Wiederholen dessen, was Amundsen vorgibt.
Aber die äußere Handlung von „South Pole“ auf der ganz in Weiß ausgeschlagenen Bühne (Karin Connan und Hans Neuenfels), in der dem Auge keine farbliche Ruhezone und durch die Leere des Raumes auch keinerlei atmosphärischer Halt geboten wird, ist nur die eine, die sichtbare Ebene der Oper. Denn Holloway, Srnka und auch Regisseur Hans Neuenfels geben in erster Linie tiefe Einblicke in das Seelenleben ihrer Hauptfiguren. Und das ist die weitaus interessantere Schicht, die es freizulegen gilt. Scott und Amundsen könnten als Charaktere und auch in ihren Verhaltensmustern gegensätzlicher nicht sein. Und so geht jeder von beiden in der Extremsituation Antarktis mit beißender Kälte, massiven Entbehrungen und bitterer Einsamkeit – aber auch mit den eigenen Männern – auf seine Art und Weise um. Beide stellen sich immer wieder die Frage nach dem Warum. Warum tue ich mir (und den anderen) diese Strapazen an? Geht es überhaupt um den Pol? Oder vielmehr um die Überwindung des eigenen Ich? Um die Angst vor dem Scheitern? Die Handlung wird immer wieder von Visionen und Träumen Scotts und Amundsens unterbrochen. In diesen erscheinen den beiden jene Frauen, die in ihrem Leben eine zentrale Rolle gespielt haben – und plötzlich sind die beiden Heroen des Eises nur noch kleine, schwache Hanswürste. Scott rasend vor Eifersucht, Amundsen gar unfähig zu jeder Beziehung.
Die Team nähern sich Breitengrad für Breitengrad ihrem Ziel – und nun gesteht Neuenfels zuerst den Norwegern und anschließend den Engländern endlich einmal die ganze Bühne zu. Merkwürdig unterdrückte Freude bei Amundsen und anderseits tiefste Enttäuschung bei Scott greifen sich hier Raum. Und während Scotts Team auf der Rückreise elend zugrunde geht, feiert Amundsen im Frack seinen Sieg nach der Rückkehr nach Norwegen. Doch auf die telegraphische Meldung von Scotts Tod reagiert Amundsen mit den eigentümlichen Worten „Scott, ich gratuliere. Der Pol gehört Dir.“ Und hier, genau hier gelingt Srnka der stärkste musikalische Eindruck des Abends. Mit einem wie improvisiert wirkenden, aufwärtsgerichteten kurzen Melisma. Amundsen ist menschlich geworden.
Srnkas Musik gewinnt an nicht allzu vielen Stellen wirklich dramaturgische Bedeutung. Aber vielleicht war das auch nicht sein Plan. Denn im ausgezeichneten Programmheft erläutert er, was es für ihn heißt, eine Oper zu schreiben: „… einen möglichst offenen Code zu entwickeln, der diese weitere Kunstform (die Regie, JPU) nie aus den Augen verliert und ihr genügend Möglichkeiten anbietet.“ Ein offener Code also. In der Tat entwickelt Srnka wunderbare Klangcluster, flächige Strukturen mit faszinierenden instrumentalen Ballungen einerseits und Auffächerungen andererseits. Durchkomponiert ist das alles mit einem Händchen für wirklich außergewöhnliche Instrumentation. Mir persönlich fehlt dennoch das Gefühl des Vorwärtstreibens, oftmals wirken die Klangstrukturen für meinen Geschmack zu statisch. Srnkas Musik ist eine Schicht voller Chiffren, die er situationsabhängig abwandelt und dechiffriert. Ausgezeichnet lässt sich das Auseinanderdriften der anfangs einheitlichen musikalischen Sprache Scotts und Amundsens bis zur völligen Auflösung im zweiten Teil miterleben. Kirill Petrenko am Pult des Bayerischen Staatsorchesters setzt sich mit Hingabe für diese Musik ein und entwickelt – stets mit einem wachen Blick auf die Sänger – eine Gestaltung, die kühl, differenziert, geschichtet wirkt. Denn Kälte und Isolation kann man als Hörer auf diese Art am besten spüren. Trotz der ungewöhnlich großen Besetzung widersteht Petrenko der Versuchung, vordergründig laut zu sein. Ein forte bedeutet bei ihm eben nicht laut, sondern kräftig.
Ich weiß, dass ich mir mit den folgenden Sätzen unter der Anhängerschaft Rolando Villazóns keine Freunde machen werde. Aber ich halte ihn als Robert Scott für eine Fehlbesetzung. Musikalisch beherrscht er die Partie. Aber man muss leider – und ich tue das mit tiefstem Bedauern – feststellen, dass er der gewiss nicht exponierten Rolle sowohl stimmlich, also auch stimmtechnisch nicht wirklich gewachsen ist. Kaum einer seiner Töne schwingt frei, strömt, vielmehr erzeugt Villazón (die wenigen hohen) Töne quasi nur noch über ungesunden Druck im Stimmapparat. Vieles klingt gepresst. Und darstellerisch hat mich Villazón ebenfalls nicht überzeugen können. Er verkörpert keinen Gescheiterten, er spielt ihn lediglich. Das wird umso deutlicher, weil ihm mit Thomas Hampson als eiskalter Siegertyp Amundsen ein gestandener Sängerdarsteller gegenübersteht, der eben nicht – wie Villazón es quasi permanent tut – die große, oftmals hektische Sängergeste, das Pathos, sucht, sondern viel stärker mit kleinen Aktionen, manchmal nur mit den Händen, mit den Fingern arbeitet. Sein Agieren ist überlegt, durchdacht und wirkt dennoch authentisch gefühlt. Stimmlich ist Hampson an diesem Abend überragend. Und auch die Expeditions-Teams sind durchgehend hochklassig besetzt. Als vokales Gegengewicht zu diesen tenoralen und baritonalen Männergesellschaften überzeugen Mojca Erdmann und Tara Erraught in den höchsten Lagen.
Als ich nach zweieinhalb Stunden musikalischer Expedition wieder auf dem Max-Joseph-Platz stehe und einen Blick zurück auf das Nationaltheater werfe, hat es mittlerweile aufgehört zu schneien und auch die antarktische Klanginstallation hat sich aufgelöst. Aber die Klänge und Bilder dieses Abends mit „South Pole“ bleiben mir noch lange im Gedächtnis. Ich empfehle „South Pole“ nicht nur dem klassischen Opernliebhaber, sondern vor allem jenen Menschen, die über sich selbst und über ihr eigenes Leben in Extremsituationen nachdenken (möchten). In „South Pole“ erhält man dazu wunderbare Anregungen. Und man kann sich diese zeitgenössische Oper guten Gewissens mehr als nur einmal anschauen. So viel gibt es in ihr zu entdecken.
Einige Impressionen von diesem Abend findet ihr in der
Galerie